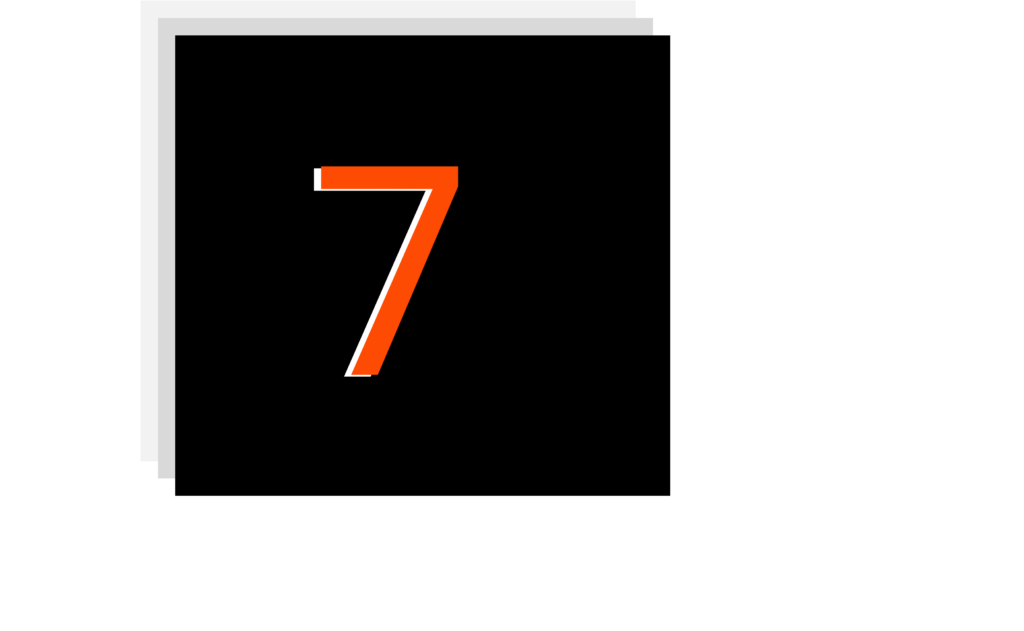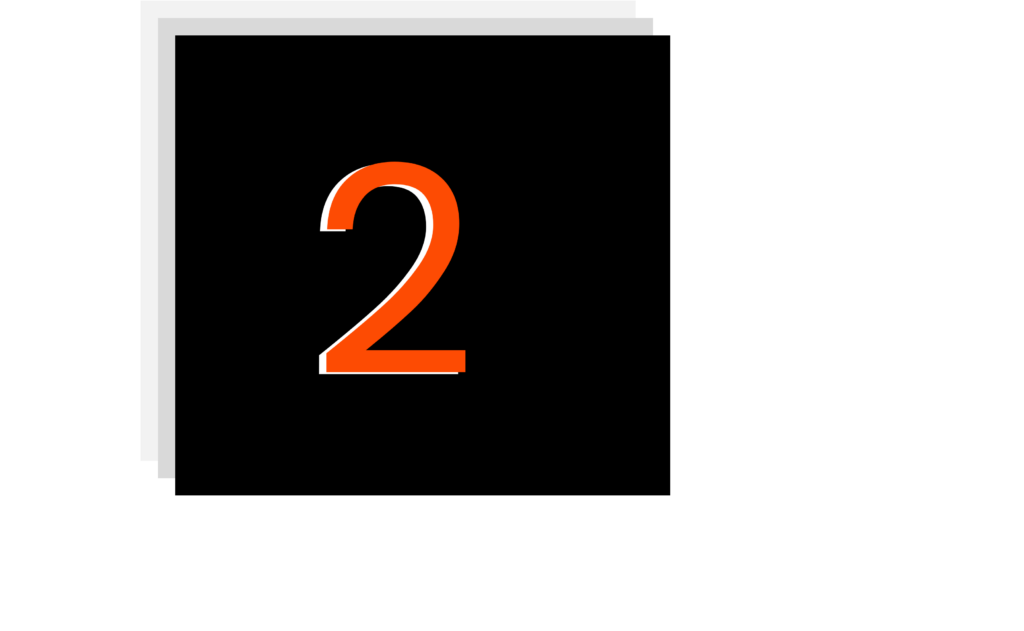Organisationstheorie-Klassiker für die Praxis (8): Cyert & March und die lokalen Rationalitäten
Die Verhaltenswissenschaftler Richard Cyert und James March habe ich im Rahmen meiner Serie zu Organisationstheorie-Klassikern schon einmal erwähnt, als ich das Garbage Can Model vorgestellt habe. In diesem Beitrag tauchen sie erneut auf, da sich die Arbeit dieser brillanten Organisationsdenker nicht auf ein einziges Modell beschränken lässt.
Ein weiteres Konzept, mit dem sie einen wegweisenden Beitrag zum Verständnis von Organisationen geleistet haben, sind die sogenannten „lokalen Rationalitäten“. Zusammengefasst lautet die Aussage dahinter: An welcher Stelle in der Organisation ich mich befinde, beeinflusst meine Denkweise. Unterschiedliche Organisationseinheiten haben abweichende Maßstäbe dafür, was sie als rational bewerten. Das liegt unter anderem daran, dass Informationsflüsse in Organisationen durch ihre Strukturen bestimmt werden und somit Personen an unterschiedlichen Stellen unterschiedliches Wissen haben.
Das Konzept der lokalen Rationalitäten unterscheidet sich von machtorientierten Modellen insofern, dass den Akteuren in der Regel nicht bewusst ist, dass ihre Denkweise durch ihre Position in der Organisation geprägt ist. Das ist intuitiv nachvollziehbar: Mir selbst kommt meine eigene Denkweise meist als Richtschnur der Rationalität vor; dass nicht nur andere, sondern auch ich selbst Verzerrungen unterliege, bleibt latent. Lokale Rationalitäten sind daher nicht deckungsgleich mit Mikropolitik, da die Organisationsmitglieder abseits von Eigeninteressen tatsächlich davon überzeugt sind, im besten Sinne der Organisation zu agieren.
Für die Praxis ist das Konzept hoch relevant: In nahezu jedem meiner Projekte sind mir Konfliktsituationen begegnet, in denen Vertreter:innen verschiedener Organisationseinheiten in jeweils bester Absicht sich entgegenstehende Positionen vertreten haben. Diese Situation gehört zu den Fällen, in denen das Einbringen eines theoretischen Modells bereits einen hilfreichen intervenierenden Effekt haben kann, da die Erkenntnis, dass beide Seiten unterschiedliche Ziele der Organisation vertreten, dabei hilft, Diskussionen von der Personen- auf die Sachebene zu verlagern.